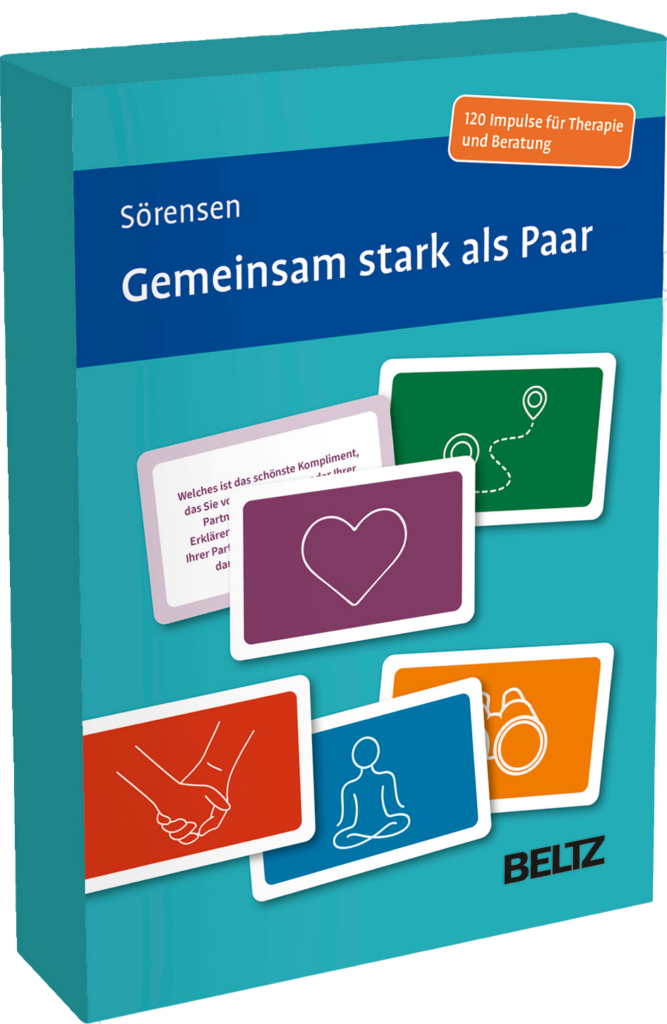Monogamie wird von vielen Menschen als selbstverständlich angesehen. Aber die gesellschaftlichen Vorstellungen von Liebe und Romantik verändern sich. Klassische Beziehungsformen werden aktuell immer mehr ergänzt um andere Modelle. Es gibt viele Spielarten. Und da geht es nicht nur um offene Beziehungen, sondern um viele andere, unterschiedliche Formen von Partnerschaft.
In meiner Paarberatungs-Praxis und auch in der Beziehungsberatung einzelner Personen werde ich häufiger auf die Themen offene Beziehung, Polyamorie und andere Beziehungsformen angesprochen.
In diesem Artikel zeige bespreche ich einige der häufigsten Beziehungsformen, damit du ein besseres Verständnis darüber bekommst, was möglich ist.
Wenn du Vielfalt leben oder zumindest gedanklich zulassen möchtest, wenn ihr euch als Paar explorieren wollt und Neues erforschen möchtet, aber auch, wenn du dich/ ihr euch nur informieren willst/wollt, erfährst du, welche Vorzüge und Herausforderungen mit der jeweiligen Beziehungsform verbunden sind. Und ich zeige dir mögliche Regeln für deren Umsetzung auf.
Und in unserer Podcastfolge spricht Hanser mit mir über die Vielfalt heutiger Beziehungsformen. Er stellt mir Fragen dazu, wie diese Modelle aussehen können, was sie jeweils stark macht – und wo die Stolperfallen liegen. Ich berichte dabei aus meiner Praxis als Paarberaterin, welche Fragen Menschen in diesem Zusammenhang bewegen: Wie viel Nähe und Verbindlichkeit brauche ich? Wie viel Freiheit ist mir wichtig?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Podigee. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Was für alle Beziehungsformen gilt
Es gibt keine Standardform für die Liebe – nur die, die zu dir passt.
Esther Perel
Unterschiedliche Beziehungsmodelle können dein Liebesleben erweitern und dich und euch wachsen lassen. Gleichzeitig: Entscheidungen in Partnerschaften – und zwar nicht nur über das Partnerschaftsmodell – müssen immer mit beiden Partnern abgestimmt und gemeinsam getroffen werden. Das erfordert viel Beziehungskompetenz. Je größer die Anzahl der Personen ist, mit denen du Entscheidungen zu treffen hast, desto komplexer werden die Bedingungen.
Die Beziehungsmodelle
Es gibt keine Standardform für die Liebe – nur die, die zu dir passt.
Esther Perel
Unterschiedliche Beziehungsmodelle können dein Liebesleben erweitern und dich und euch wachsen lassen. Gleichzeitig: Entscheidungen in Partnerschaften – und zwar nicht nur über das Partnerschaftsmodell – müssen immer mit beiden Partnern abgestimmt und gemeinsam getroffen werden. Das erfordert viel Beziehungskompetenz um als Paar eine gemeinsame Beziehung zu planen. Je größer die Anzahl der Personen ist, mit denen du Entscheidungen zu treffen hast, desto komplexer werden die Bedingungen.
Monogamie
Beschreibung
Die monogame Partnerschaft ist für viele Menschen das bevorzugte Beziehungsmodell – etwa drei Viertel aller Erwachsenen wünschen sich eine exklusive Beziehung mit nur einer Partnerin oder einem Partner. Monogamie beschreibt eine auf Exklusivität beruhende Bindung – emotional wie sexuell – mit dem Ziel, unersetzlich und einzigartig füreinander zu sein.
Diese Form der Partnerschaft ist tief in unserer Gesellschaft verankert und wird juristisch sowie kulturell stark gefördert – etwa durch das Eherecht, steuerliche Vorteile oder Erbrechtsregelungen. Historisch gesehen geht die Entstehung der Monogamie vermutlich auf die Sesshaftwerdung des Menschen vor rund 10.000 Jahren zurück, als Besitz und Erbfolge an Bedeutung gewannen.
Es gibt zwei Varianten von Monogamie:
- Sexuelle Monogamie, bei der körperliche Treue im Fokus steht
- Soziale Monogamie, bei der das Leben (z. B. Kinder, Haushalt) gemeinsam gestaltet wird, sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung aber nicht ausgeschlossen sind.
Monogamie ist vor allem eine bewusste Entscheidung – ein gegenseitiges Versprechen: „Wir haben nur uns.“
Vorteile
- Du musst deinen Partner oder deine Partnerin nicht mit jemand anderem teilen.
- Monogamie kann das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und emotionaler Exklusivität erfüllen.
- Sie stärkt oft das Gefühl von Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.
- Wer sich danach sehnt, für einen Menschen der oder die Einzige zu sein, wird in dieser Form Erfüllung finden.
Herausforderungen
- Monogamie ist vermutlich weniger ein Ausdruck unserer biologischen Natur als vielmehr das Ergebnis gesellschaftlicher Prägung.
- Das Bedürfnis nach Abwechslung, sexueller Neugier oder persönlichem Wachstum kann durch die monogame Struktur eingeschränkt werden.
- Unterschiedliches sexuelles Verlangen kann schnell zum Spannungsfeld werden – etwa wenn Sexualität als Druckmittel erlebt wird.
- Ein häufiger Mythos ist, dass Monogamie automatisch Intimität garantiert – dabei braucht auch sie bewusste Pflege.
Regeln für die Umsetzung
- Monogamie funktioniert nur, wenn sie bewusst gewählt und regelmäßig reflektiert wird.
- Klare, ehrliche Kommunikation über Bedürfnisse, Grenzen und Wünsche ist essenziell.
- Freiräume innerhalb der Beziehung erhalten die Spannung – einander ein Stück weit fremd zu bleiben, kann die Nähe vertiefen.
- Gemeinsame Rituale, Achtsamkeit und regelmäßiger Austausch helfen, die emotionale und sexuelle Verbindung lebendig zu halten.
Die offene Frage
Auch wenn viele Menschen Monogamie als Ideal leben (möchten), zeigt sich in der Realität häufig ein anderes Bild: die serielle Monogamie. Dabei wird nicht eine lebenslange Partnerschaft angestrebt, sondern eine Reihe von aufeinanderfolgenden monogamen Beziehungen geführt – jeweils mit dem Anspruch auf Exklusivität. Serielle Monogamie ist dabei kein Beziehungsmodell im engeren Sinne, sondern eher ein Muster des Liebens in Etappen. Die offene Frage lautet also: Ist Monogamie heute noch ein lebenslanges Versprechen – oder eher eine zeitlich begrenzte Phase mit exklusivem Anspruch?
Offene Beziehung
Beschreibung
Eine offene Beziehung führen Paare, die sich zwar eine verbindliche Partnerschaft wünschen, aber sexuelle Erfahrungen mit anderen Menschen zulassen. Die romantische Liebe bleibt exklusiv innerhalb der Beziehung – der sexuelle Bereich hingegen wird bewusst geöffnet.
Häufig entsteht der Wunsch nach einer offenen Beziehung, wenn in einer Langzeitbeziehung das Gefühl von Neuheit, Spannung oder Begehrtwerden fehlt. Eine offene Beziehung kann dabei helfen, sexuelle Neugier zu stillen, unterschiedliche Bedürfnisse auszuleben und die eigene Attraktivität außerhalb der Beziehung zu erfahren – ohne die Partnerschaft aufgeben zu müssen.
Die Modelle offener Beziehungen sind vielfältig: Manche Paare legen Wert darauf, von Begegnungen mit anderen zu erfahren – andere möchten lieber keine Details hören: Don’t ask, don’t tell, bis hin zu: Wir leben offen, aber wir reden nicht darüber.
Manchen ist emotionale Exklusivität besonders wichtig, während andere auch emotionale Nähe zu außenstehenden Personen akzeptieren. Manche besuchen gemeinsam Sexpartys oder führen gelegentlich Dreier; andere treffen sich getrennt mit anderen Personen. Wichtig ist: Eine offene Beziehung ist kein Fremdgehen – sondern beruht auf klarer Absprache und Zustimmung beider Partner.
Swingen – eine Spielart offener Sexualität
Manche Paare entscheiden sich nicht für eine dauerhafte Öffnung der Beziehung, sondern suchen gezielt sexuelle Reize außerhalb – etwa durch den Besuch von Swingerclubs. Swingen bedeutet: Erlaubte sexuelle Kontakte mit anderen (auch gleichzeitig, mit Beobachtung oder Partnertausch), jedoch meist ohne emotionale Bindung. Diese Praxis ist besonders dann stabil, wenn sie auf einer gefestigten und ehrlichen Partnerschaft beruht und klare Absprachen getroffen wurden.
Vorteile
- Eine offene Beziehung kann ein Weg sein, sexuelle Unterschiede oder Wünsche innerhalb der Partnerschaft konstruktiv zu lösen.
- Die sexuelle Freiheit außerhalb der Partnerschaft kann das Begehren im Paar neu entfachen und die eigene Lebendigkeit stärken.
- Wer trotz sexueller Kontakte mit anderen beim Partner oder der Partnerin bleibt, sendet damit manchmal sogar ein starkes Liebeszeichen: Ichwähle dich – immer wieder neu.
Herausforderungen
- Eifersucht, Unsicherheit und das Gefühl, nicht (mehr) zu genügen, gehören zu den häufigsten inneren Herausforderungen.
- Wenn nur einer von beiden die Beziehung öffnen möchte und der andere lediglich zustimmt, um den Partner oder die Partnerin nicht zu verlieren, gerät das Modell schnell in eine Schieflage.
- Offene Beziehungen erfordern ein hohes Maß an Selbstreflexion: Alte Bindungserfahrungen, persönliche Bedürfnisse und Grenzen sollten offen angeschaut und benannt werden.
- Belastungen wie Krankheit, Schwangerschaft oder emotionale Krisen stellen offene Beziehungen häufig vor zusätzliche Herausforderungen.
- Wer sich verliebt oder emotionale Nähe außerhalb der Beziehung entwickelt, kann das bestehende Gleichgewicht stark ins Wanken bringen.
Regeln für die Umsetzung
- Grundvoraussetzung ist beiderseitiges Vertrauen – und eine ehrliche Kommunikation über Bedürfnisse, Ängste und Wünsche.
- Klare Absprachen sind essenziell: z. B. mit wem, wann, wie häufig, welche Informationen geteilt werden und wo Grenzen liegen (z. B. kein Sex mit gemeinsamen Freunden, keine Übernachtungen, keine Treffen ohne Verhütung).
- Ein Vetorecht kann Sicherheit schaffen, ebenso wie die Option, das Modell jederzeit anzupassen oder wieder zu schließen.
- Festgelegte Zeiten für Paarzeit helfen, die Beziehung zueinander nicht aus dem Blick zu verlieren.
- Es ist hilfreich, offen über Unsicherheiten und Eifersucht zu sprechen, statt diese zu verdrängen – nur so kann Vertrauen wachsen.
Die offene Frage
Offene Beziehungen stellen die Idee der sexuellen Exklusivität infrage – aber nicht zwangsläufig die emotionale Bindung. Trotzdem bleibt die Frage offen, ob eine Öffnung langfristig die Beziehung stärkt – oder ob sie lediglich eine Antwort auf unerfüllte Bedürfnisse ist, die innerhalb der Beziehung nicht besprochen werden konnten. Besonders dann, wenn der Wunsch nach einer Öffnung aus einer Affäre heraus entsteht, oder wenn nur ein Partner den Impuls dazu hat, wird es schwierig. Die offene Beziehung ist daher weniger ein „Rettungsanker“ – sondern vielmehr ein bewusster, gemeinsamer Gestaltungsweg, der Mut, Vertrauen und Klarheit erfordert.
Polyamorie
Beschreibung
Polyamorie bezeichnet eine Beziehungsform, in der Menschen gleichzeitig mehrere romantische und/oder sexuelle Beziehungen führen – auf Basis von Offenheit, Einvernehmen und Transparenz. Dabei geht es nicht primär um sexuelle Kontakte wie bei vielen offenen Beziehungen, sondern um das bewusste Teilen von emotionaler Nähe, Intimität und auch Alltag mit mehreren Partnern bzw. Partnerinnen.
Im Gegensatz zur Monogamie oder offenen Beziehung ist in der Polyamorie oft mehr als nur ein Mensch bedeutsam – emotional, sexuell, teils auch sozial. Manche führen dabei eine zentrale Beziehung mit einer „Hauptpartnerin“ oder einem „Hauptpartner“ (Primärbeziehung), andere leben egalitäre Beziehungsnetzwerke ohne Hierarchie. Auch Modelle wie Triaden (drei gleichwertige Beziehungen) oder Polygynandrien (größere Gruppenbeziehungen) sind möglich.
Polyamorie erfordert ein hohes Maß an Beziehungskompetenz: Achtsamkeit, emotionale Reife, Selbstreflexion, ehrliche Kommunikation und klare Vereinbarungen sind unverzichtbar. Alle Beteiligten müssen über die Beziehungen informiert sein und ihnen zustimmen.
Vorteile
- Die Liebe darf sich frei entfalten – ohne künstliche Beschränkung auf eine einzige Person.
- Polyamorie kann emotionale, sexuelle und soziale Bedürfnisse auf vielfältige Weise erfüllen.
- Das Modell fordert und fördert intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen und Wünschen.
- Es entstehen alternative Gemeinschaftsformen mit geteiltem Alltag, Fürsorge und Verantwortung – auch im Kontext von Kindern.
- Menschen müssen nicht alle Bedürfnisse von nur einer Person abdecken – dies entlastet viele Beziehungen.
Herausforderungen
- Eifersucht und Unsicherheit: Diese Gefühle werden nicht ausgeschlossen, sondern müssen bewusst verhandelt und integriert werden.
- Ungleichgewicht: Aufmerksamkeit, Zeit, emotionale Verbindlichkeit und Lebensgestaltung können schnell ungleich verteilt sein.
- Komplexität: Mehr Beteiligte bedeuten mehr Bedürfnisse, Erwartungen, Absprachen – das erhöht den Kommunikationsbedarf enorm.
- Sozialer Druck: Eventuelle gesellschaftliche Ablehnung, Missverständnisse im Umfeld oder Vorurteile (z. B. bei Elternschaft) können belastend sein.
- Kinder: Die Frage nach Rollen („Wer ist Mama? Wer ist was?“), Klarheit und Struktur ist wichtig – aber auch der Zugang zu vielen Bezugspersonen kann ein Gewinn sein.
- Zeitmanagement: Beziehungen brauchen Zeit. Polyamorie braucht davon besonders viel. Ein gemeinsamer Kalender hilft – aber Organisation ersetzt keine emotionale Präsenz.
Voraussetzungen/ Regeln für die Umsetzung
- Radikale Ehrlichkeit: Gefühle, Wünsche, Ängste, Vereinbarungen – alles sollte transparent sein.
- Klare Absprachen: Wer hat welche Rolle? Welche Grenzen gelten? Gibt es Prioritäten? Was wird geteilt – was nicht?
- Regelmäßiger Austausch: Über emotionale Befindlichkeiten, Erwartungen und mögliche Veränderungen.
- Achtsamkeit für alle Beteiligten: Niemand sollte sich übergangen fühlen – dazu gehört die Bereitschaft, auch unangenehme Themen zu klären.
- Innere Stabilität: Wer sich selbst gut kennt, mit eigenen Ängsten umgehen kann und bereit ist, anderen Vertrauen zu schenken, wird besser mit dieser Beziehungsform zurechtkommen. Lies hierzu auch meinen Blogartikel Was ist Bindungsangst.
- Akzeptanz für Veränderung: Gefühle können sich ändern – Beziehungen entwickeln sich dynamisch, auch in polyamoren Konstellationen.
Die offene Frage
Wie dauerhaft ist Polyamorie wirklich?
Ist Polyamorie ein tragfähiges Langzeitmodell – oder bleibt es ein intensiver Lebensabschnitt mit Verfallsdatum? Was passiert, wenn eine Beziehung wichtiger wird als die anderen – oder wenn Kinder dazukommen? Wie lassen sich Bindung, Verlässlichkeit und Verantwortung mit der Idee emotionaler Offenheit und gleichzeitiger Liebe zu mehreren Menschen vereinbaren?
Freundschaft plus
Beschreibung
Bei einer Freundschaft plus (auch: Friends with Benefits) steht die freundschaftliche Verbindung im Vordergrund – erweitert um körperliche Intimität und/oder Sexualität. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Partnerschaft, sondern um eine freundschaftlich geprägte Beziehung ohne romantische Definition, ohne gemeinsame Lebensplanung und ohne exklusive Verbindlichkeit. Man mag sich sehr, genießt Nähe und Vertrautheit – möchte aber keine klassischen Beziehungsregeln oder eine feste Paaridentität etablieren.
Diese Form wird oft gewählt, wenn aktuell keine Partnerschaft gewünscht ist oder möglich erscheint, körperliche Nähe jedoch ein Bedürfnis bleibt. Auch wenn Freundschaft plus kein eigentliches Beziehungsmodell im Sinne einer verbindlichen Partnerschaft ist, enthält sie doch ein zentrales Beziehungselement: Vertrautheit und Verlässlichkeit. Die Exklusivität – sofern sie überhaupt Thema ist – bleibt jedoch offen und unverbindlich.
Vorteile
- Sexualität mit einer vertrauten Person, in einem geschützten und wertschätzenden Rahmen.
- Keine Verpflichtungen im Sinne klassischer Partnerschaft – das ermöglicht Freiraum, Leichtigkeit und Selbstbestimmung.
- Bestehende freundschaftliche Nähe kann vertieft werden, ohne das Bedürfnis nach romantischer Bindung erfüllen zu müssen.
- Für Menschen, die keine Beziehung suchen, aber körperliche Intimität vermissen, kann dieses Modell eine stimmige Alternative sein.
Herausforderungen
- Es braucht viel Klarheit und Kommunikation über Bedürfnisse, Erwartungen und Grenzen.
- Die Außenwelt reagiert oft irritiert, weil die Beziehung keiner klaren gesellschaftlichen Norm entspricht („Ist das jetzt ein Paar oder nicht?“).
- Die Freundschaft kann unter Druck geraten, wenn unausgesprochene Gefühle oder Missverständnisse entstehen.
- Es besteht ein emotionales Ungleichgewicht, wenn sich eine der beiden Personen verliebt oder mehr möchte als vereinbart.
Regeln für die Umsetzung
- Gemeinsame Klärung: Was ist erlaubt? Was bedeutet die Verbindung für uns – und was nicht?
- Regelmäßige Gespräche helfen, sich über mögliche Veränderungen oder Unstimmigkeiten bewusst zu werden.
- Auch das Ende sollte thematisiert werden: Was passiert, wenn einer eine neue Beziehung eingeht oder sich verliebt?
- Es ist wichtig, Eifersucht nicht zu tabuisieren, sondern als möglichen Bestandteil ernst zu nehmen – auch, wenn man sich auf eine unverbindliche Verbindung geeinigt hat.
- Nicht zuletzt: Der respektvolle Umgang miteinander bleibt zentral – sowohl freundschaftlich als auch körperlich.
Die offene Frage
Freundschaft plus erscheint oft als eine „leichte“, beziehungsfreie Alternative zur Partnerschaft – birgt jedoch ähnliche emotionale Komplexitäten. Die offene Frage lautet daher: Ist Freundschaft plus wirklich ein selbstbestimmtes, stabiles Modell – oder eher ein Übergangszustand, bei dem oft unausgesprochene Erwartungen mitschwingen? Und: Wie viel Nähe, Sex und Intimität verträgt eine Freundschaft, bevor sich ihre Grundlage verschiebt?
Living Apart Together (LAT)
Beschreibung
„Living Apart Together“ beschreibt eine Beziehungsform, bei der beide Partner eine feste, verbindliche Partnerschaft führen – jedoch ohne zusammenzuleben. Die emotionale und romantische Bindung besteht, aber es gibt zwei getrennte Haushalte. Dieses Modell räumlicher Trennung in der Beziehung vereint Nähe und Autonomie und bietet Raum für individuelles Leben innerhalb einer verbindlichen Partnerschaft.
LAT wird häufig gewählt von Paaren, die bereits negative Erfahrungen mit dem Zusammenleben gemacht haben, die sich nach Unabhängigkeit sehnen oder die sich bewusst gegen das klassische Modell von gemeinsamer Wohnung und Alltag entscheiden. Auch Paare, bei denen einer der Partner häufig beruflich unterwegs ist oder Pendelzeiten vermeiden will, finden in LAT eine passende Form des Zusammenseins.
Vorteile
- Beide Partner können ihr eigenes Leben, ihren Alltag und ihren Wohnraum nach eigenen Vorstellungen gestalten.
- Der Zauber des Wiedersehens bleibt erhalten – gemeinsame Zeit wird bewusst gestaltet.
- Konflikte durch Alltagsstress oder unterschiedliche Lebensgewohnheiten (Ordnung, Schlafrhythmus, Freizeitgestaltung) können reduziert werden.
- Besonders geeignet für Menschen mit starkem Autonomiebedürfnis, hohem beruflichem Engagement oder besonderem Rückzugsbedürfnis.
Herausforderungen
- Gemeinsame Routinen, Alltagsnähe und spontane Nähe fehlen häufig.
- Es besteht die Gefahr einer Entfremdung oder Parallelwelten, wenn keine bewusste Pflege der Beziehung erfolgt.
- Das Umfeld (Familie, Freundeskreis, Gesellschaft) reagiert möglicherweise mit Unverständnis oder Irritation – vor allem, wenn Kinder involviert sind.
- Besonders in Krisen oder bei Krankheit wird deutlich, dass das Modell klare Absprachen braucht: Wer trägt Verantwortung? Wie sieht Fürsorge aus?
Regeln für die Umsetzung
- Bewusste Verabredungen für gemeinsame Zeit, Rituale und Kommunikation sind essenziell.
- Es braucht einen ständigen Aushandlungsprozess: Wie viel Nähe, wie viel Abstand ist für beide stimmig?
- Offenheit gegenüber Veränderungen: Ein LAT-Modell kann sich im Laufe der Zeit wandeln – hin zum Zusammenziehen oder zu mehr Distanz.
- Wichtig ist es, gegenseitige Erwartungen zu klären – etwa in Bezug auf Alltag, Sexualität, Krisenunterstützung und Zukunftsplanung.
- Für Paare mit Kindern oder Patchwork-Konstellationen braucht es klare Vereinbarungen zum Umgang mit Familie und Betreuung.
Die offene Frage
LAT vereint Autonomie mit Bindung – doch das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz muss immer wieder neu gefunden werden. Die offene Frage lautet daher: Wo endet gesunde Selbstständigkeit – und wo beginnt emotionale Distanz? Und: Ist LAT ein bewusst gewähltes Lebensmodell – oder eher eine Schutzstrategie vor den Verletzlichkeiten gemeinsamer Alltagsbeziehung?
Fazit zu den Beziehungsformen: Beziehung ist nicht gleich Beziehung – und das ist auch gut so
Welche Beziehungsform zu dir oder euch passt, lässt sich nicht ein für alle Mal beantworten. Partnerschaft ist ein dynamischer Prozess – nicht nur in Gefühlen, sondern auch in Lebensformen. Monogam, offen, polyamor, LAT oder Freundschaft plus: Es gibt nicht das eine „richtige“ Modell, sondern verschiedene Möglichkeiten, Nähe, Verbindlichkeit, Sexualität und Autonomie miteinander zu gestalten.
Unabhängig vom gewählten Modell gilt: Beziehungsformen brauchen bewusste Entscheidungen. Sie sind keine Selbstverständlichkeit. Es braucht Absprachen, gegenseitigen Respekt, eine Sprache für Bedürfnisse – und den Mut, diese offen mitzuteilen. Vor allem, wenn sich Wünsche oder Vorstellungen verändern.
Es geht nicht um das perfekte Modell – sondern um lebendige Beziehungen
Viele Menschen starten mit der Idee: „Alles mit einem/einer – für immer.“ (AMEFI) Doch was, wenn sich das im Laufe der Zeit nicht erfüllt? Oder nicht mehr stimmig anfühlt? Dann darf hinterfragt werden – ohne Schuldzuweisung. Veränderung bedeutet nicht automatisch Scheitern. Im Gegenteil: Reflexion und Entwicklung sind Zeichen von Beziehungspflege.
Auch in stabilen Beziehungen können Unzufriedenheit, sexuelle Diskrepanzen (bis zu einer Beziehung ohne Sex) oder der Wunsch nach Veränderung auftauchen. Nicht immer muss dann gleich das Beziehungsmodell gewechselt werden. Oft helfen bereits neue Impulse, Rituale oder Gespräche, um als Paar wieder in Bewegung zu kommen:
- Wie können wir uns weiterentwickeln, ohne uns zu verlieren?
- Was brauchen wir, damit unsere Beziehung lebendig bleibt – auch ohne Dritte?
Wenn deine Partnerin oder dein Partner den Wunsch nach einem anderen Beziehungsmodell äußert, kann das irritieren oder verunsichern. Und gleichzeitig ist es ein Zeichen von Vertrauen und Offenheit. Du darfst Nein sagen – und du darfst Danke sagen für die Ehrlichkeit. Denn auch in guten Gesprächen dürfen Meinungen unterschiedlich bleiben.
Mehr differenzierte Informationen bekommst du häufig in speziellen Podcastfolgen. Du kannst dich über die besten Podcasts für Paare in meinen Blog orientieren. Sehr informativ ist insbesondere die Folge (2 Teile) des Podcasts „Ist das normal?“ In den beiden Folgen ist Wissenschaftsjournalistin Alina Schadwinkel von ZEIT ONLINE im Gespräch mit der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner:
Mit jeder Beziehungsform gewinnst du – und du zahlst auch einen Preis
Jede Partnerschaftsform hat Vor- und Nachteile. Wer sich für Monogamie entscheidet, entscheidet sich oft für Sicherheit – und verzichtet möglicherweise auf sexuelle Vielfalt. Wer polyamor lebt, lebt emotionale Freiheit – und muss mit Unsicherheiten, Eifersucht oder Komplexität umgehen. Auch offene Beziehungen, LAT oder Freundschaft plus brauchen klare Regeln und viel Kommunikation.
Es geht also weniger um richtig oder falsch – sondern darum, ob es zu dir (und euch) passt.
Fragen die helfen können, deinen Weg zu finden
- Worin liegt für mich die Chance, in einer monogamen Beziehung zu leben?
- Wie viel Verbindlichkeit brauche ich – wie viel Freiheit?
- Was bedeutet Treue für mich?
- Ist Sex außerhalb der Partnerschaft für mich bedrohlich – oder denkbar?
- Wo sind meine inneren Grenzen – und wo bin ich bereit, etwas auszuprobieren?
- Kann ich mir vorstellen, mein Beziehungsmodell im Laufe der Zeit zu verändern?
Gute Zeitpunkte für diese Fragen
Manchmal braucht es äußere Anlässe, um innezuhalten: Ein Hochzeitstag, der Jahreswechsel, eine Lebenskrise oder das Ausziehen der Kinder. Solche Wendepunkte sind Gelegenheiten für ein gemeinsames Innehalten: „Wo stehen wir – und wo wollen wir hin?“ Wer sich als Paar regelmäßig Zeit nimmt, um Bilanz zu ziehen und gemeinsam neue Wege zu denken, stärkt seine Verbindung. Ganz gleich, in welcher Form die Liebe gelebt wird.
Meine Buchempfehlungen zum Thema Beziehungsformen
Friedemann Karig, Wie wir lieben: Vom Ende der Monogamie*
In seinem Buch stellt Friedemann Karig infrage, ob die traditionelle monogame Beziehung noch zeitgemäß ist, und zeigt, warum viele Menschen nach neuen Formen des Zusammenlebens suchen. Anhand persönlicher Geschichten und gesellschaftlicher Analysen beschreibt er, welche Herausforderungen, Sehnsüchte und Möglichkeiten in offenen, polyamoren oder anderen alternativen Beziehungsmodellen stecken. Dabei geht es nicht nur um neue Strukturen, sondern auch um den Wunsch nach echter Nähe, Freiheit und ehrlicher Kommunikation in der Liebe.
Treue gilt als Beziehungsstandard, ist in der Realität aber oft die Ausnahme. Untreue wird meist als Bedrohung gesehen – dabei kann sie Ausdruck tiefer Gefühle sein, während Treue auch bloße Routine bedeuten kann. Nie zuvor gab es so viele Perspektiven auf Liebe und Beziehung. Doch der Wunsch nach Exklusivität bleibt stark. Dieses Buch fragt: Wie lassen sich Treuewunsch und Sehnsucht nach Freiheit miteinander vereinbaren – und welche Wege führen aus diesem inneren Widerspruch?